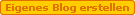Die Shamian-Insel
Die Shamian-Insel am Nordufer des Perflusses ist durch einen künstlichen Kanal vom Festland abgetrennt worden und war im 19. Jahrhundert britisches und französisches Mandatsgebiet. Konsulats- und Administrationsgebäude im Kolonialstil, bestens erhalten bzw. renoviert, prägen das Bild. Das "Orient-Express" im einstmals französischen Mandatsgebiet ist ein Restaurant mit einer Lok im Garten, das Essen wird in ausrangierten Waggons serviert. Auch die Deutschen hatten hier ein Konsulat, das der Sowjets ist mal wieder am schlechtesten in Schuss. Polen hat hier heute noch eine Vertretung. In die anderen pittoresken Säulenbauten sind Banken und Hotels eingezogen oder kleine Läden wie "Jenny's Place", in dem es gerade gähnend leer ist. Hier gibt es Kinderkleidung und Souvenirs. Jenny spricht gut Englisch; sie bittet mich auf ein Schwätzchen hinein, erzählt mir, dass sie eigentlich aus Chengdu komme. Sei sie denn zum chinesischen Neujahrsfest gar nicht in die Heimat gefahren, frage ich. "Wenn du meinen Laden für die Zeit schmeißt, kann ich fahren", erwidert sie und zeigt mir ein paar Postkarten mit Motiven aus der Zeit, als Guangzhou noch Kanton war, bevölkert von Chinesen mit langen geflochtenen Zöpfen und auffällig dunkler Haut, besiedelt von Ausländern in piekfeiner Kleidung und befahren von Rikschas und Handkarren.
Vor dem "Kulturpark", der einige Sportgeräte für den des Müßiggangs müden Chinesen anbietet, werde ich von einer Frau und ihrer Tochter angebettelt. Statt sich zu freuen an dem einen Yuan, den ich in der Regel gebe, deuten sie auf den 5-Yuan-Schein in meinem Portmonee. Es gibt auch noch andere, die sie fragen können, gebe ich zurück. Im Kulturpark rupfe ich mir in einem unbeobachteten Moment eine Mandarine von einem der Sträucher, die hier, aus Anlass des Frühlingsfestes, geradezu inflationär Eingänge und öffentliche Plätze zieren. Die Frucht ist sauer und voller Kerne, schmeckt aber sonst nicht schlecht! Ich frage mich nur, wie sich jetzt noch Mandarinen auf dem Markt absetzen lassen, wo man sie doch überall selbst ernten kann.
Die Heilig-Herz-Kathedrale, die plötzlich links von mir auf einem freien Platz aufragt, als wäre dies Barcelona und nicht die größte Stadt Südchinas, ist auch so ein Relikt aus der Epoche der westlichen Handelsniederlassungen. Als ich ihr islamisches Pendant, die Moschee Huaisheng Si endlich im Gewirr der engen Straßen gefunden habe, dämmert es bereits. Im Gebetsraum sind zwei Sino-Moslems beim Abendgebet zu sehen. Dass die Moschee sich bereits in Dunkel hüllt wie eine Muslimin in ihren Schleier, ist nicht schlimm, auf den Turm des (stummen) Muezzin darf man sowieso nicht steigen. Es sind auch nicht solche Sehenswürdigkeiten, die es mir angetan haben, sondern die hier in den Vierteln, die sich vom Nordufer des Perlflusses bis etwa zur U-Bahnlinie 1 erstrecken, noch weitgehend erhaltenen alten chinesischen Hutongs, die Wohnviertel, deren enge Gassen marode Backsteinfassaden und frei herumschwebende Stromkabel säumen und durch die kein Auto passt. Sind die Gassen einen Tick breiter, werden sie automatisch zum Marktplatz. Am bekanntesten ist der Qingping-Markt. Von Sonnenblumenkernen bis zu Hundewelpen bekommt man hier alles. In einer der engeren Gassen decke ich mich mit saftigen Apfelsinen ein, die, noch mit grünen Blättern am Stiel, gerade von einem Karren gerollt sind. Man muss ja an die jährliche Februar-Grippe denken und vorbeugen!